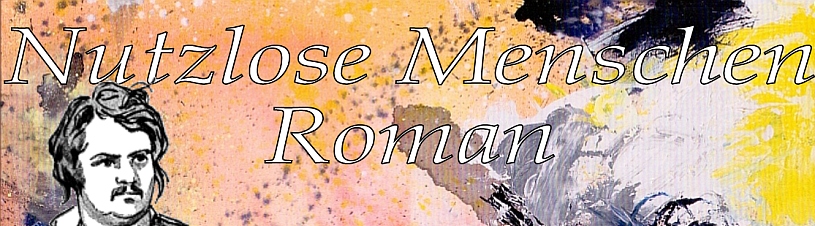»Sag nichts!«, fuhr ihm der Maler über den Mund und wandte sich zu Sapher, der erneut den warmen Bariton bewunderte, der Sontheimer zu einem beliebten Radiosprecher gemacht hätte. Klammer hob ergeben die Arme und ging einen Schritt zurück. Dann tat Sontheimer etwas ganz Außergewöhnliches, er drückte dem Dr. sein Telefon in die Hand, trat vor den überrumpelten Sapher und begann mit geübten, feingliedrigen Fingern dessen Kopf abzutasten.
»Ich darf doch?«, fragte er ohne eine Antwort zu erwarten, die ihm der verblüffte Sapher auch nicht geben konnte. Blind konnte Sontheimer nicht sein, denn er sah seinem Gast dabei direkt in die Augen. Offensichtlich hatte der Maler so etwas schon häufiger gemacht; er ging bei seiner Untersuchung zielstrebig und systematisch vor. Bei der Nasenwurzel beginnend, arbeitete er sich die Stirn und die Schläfen empor, über den Schädel zu den Ohren hinunter, dann zum Nackenansatz und wieder nach vorn bis zum Kinn. Nach dem Druck seiner leicht zitternden Finger zu urteilen, schien ihn dabei in erster Linie unter Haaren und Kopfhaut der Knochenbau des Schädels von Sapher zu interessieren.
»Da sind zwei wulstige Erhabenheiten dicht über dem Augenhöhlenrand, sie sind zu beiden Seiten der Nasenwurzel deutlich zu spüren«, sagte er während seiner Untersuchung und er klang ein wenig wie ein diagnostizierender Arzt, »sie lassen auf ein bemerkenswertes Ortsgedächtnis schließen, mit dem Zahlengedächtnis ist es bei dir nicht so weit her. Sachgedächtnis, Freigebigkeit, naja, in Ansätzen vorhanden, eher nicht. Du bist ein wenig geizig, nicht wahr? Oh, oh, nur kleine Stirnhügel, dein Humor lässt auch zu wünschen übrig … Aber hier, diese seitwärts liegenden, triangulären Aufwölbungen, deren Basen sich nach oben bis zur Wölbung der Stirn erstrecken, die sind bemerkenswert, sie weisen auf philosophischen Scharfsinn und sind übrigens auch bei Nikolaus stark ausgeprägt … Gutmütigkeit? Nein. Die zirkumskripte Hervorwölbung an der Vereinigung von Stirnbein und Kranznaht ist interessant, sie lässt auf theosophische, vielleicht sogar religiöse Tiefe schließen. Kennen du Swedenborg? Er muss dir gefallen. Nicht bewegen jetzt … Beharrlichkeit: ja, Ruhmsucht, sieh an, wie stark sie ausgeprägt ist, du spürst diese Furche hier selbst, nicht wahr? Wahrheitsliebe: Eine Vertiefung an der Spitze des Hinterhauptbeins, statt einer Wölbung; mit der Wahrheit nimmst du es also nicht so genau, bist aber vielleicht auch nur ein Träumer. Fehlt uns noch der Geschlechtstrieb …« Sontheimer betastete das Jochbein, blies die Backen auf und pfiff anerkennend. Sapher hatte dieser Charakterisierung anhand seiner Schädelknochen verständnislos zugehört, musste allerdings für sich feststellen, dass sie bis auf die theosophische Tiefe – von der er allerdings auch nicht so genau wusste, was mit ihr gemeint war – durchaus zutraf. Er sah hilfesuchend auf Klammer, der der ganzen Szene lächelnd gefolgt war.
»Vielleicht sollte ich erklären, dass unser Sontheimer ein begeisterter Freund und Anhänger der ehemals Phrenologie genannten Hirn- und Schädellehre des ehrwürdigen Franz Joseph Gall ist. Er ist, will ich vermuten, mit der letzte Apostel, den diese Lehre im 20. Jahrhundert gefunden hat. Allerdings wird sie – modisch aufgezogen – noch heute ganz ernsthaft in sogenannten Managerschulungen vermittelt«, sagte er voller Ironie in der Stimme und reichte das Handy an den Maler zurück. »Dieser Schweizer Mediziner lebte an der Wende des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert und glaubte tatsächlich mit seiner übrigens völlig unwissenschaftlichen Lehre aus dem Wuchs der Schädelknochen auf den Charakter und die Eigenschaften eines Menschen schließen zu können. Seine Zeitgenossen jedoch glaubten ihm und waren begeistert, wie einfach es plötzlich war, einen Menschen auszuforschen. Man brauchte nur ein wenig den Kopf abzutasten und schon wusste man, ob einer verfressen, ehrgeizig, ein Lügner oder ein Triebtäter war. Die Phrenologie wurde damals zusammen mit Lavaters ebenso lächerlicher Physiognomik schnell Mode in den aristokratischen Salons, vor allem in Frankreich, bis der Mesmerismus und tierischer Magnetismus, also das, was wir heute in etwa als Hypnose auf Jahrmarktsniveau bezeichnen würden, sie im Interesse ablöste. Galls Lehre trieb absurde Blüten. Es wurde ein regelrechter Kampf seiner Jünger um die Totenköpfe bedeutender Männer ausgeführt; auch der Schädel von Immanuel Kant wurde einen Tag nach seinem Tod von einem gewissen Dr. Wilhelm Gottlieb Kelch einer ausführlichen phrenologischen Untersuchung unterworfen …« Wie immer staunte Sapher die Belesenheit seines Vorgesetzten an, der in diesem Augenblick von dem Maler unterbrochen wurde:
»… und trotz allem treffen meine Aussagen über den Charakter eines Menschen anhand seiner Schädelformen mit einer fast neunzigprozentigen Sicherheit zu!«, fügte er an. er war Klammers ins Detail gehender Ausführung nur ungeduldig gefolgt. »Soviel Wahrscheinlichkeit hat nicht einmal der Wetterbericht im Fernsehen zu bieten. Und da sprichst du von lächerlich und unwissenschaftlich!«
»Womit einiges über den Wert von Statistiken ausgesagt wäre.« Klammer hatte nicht vor, klein beizugeben. »Horoskope in Tageszeitungen treffen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit zu, weil ihre Aussagen so vage und simpel gehalten sind, dass sich die absolute Mehrheit mit ihnen identifizieren kann und zwar mit jeder Aussage über jedes beliebige Sternzeichen.« Sontheimer verzog verächtlich einen Mundwinkel. Er wusste es besser.
»Die Phrenologie hat nichts mit Pendeln und Wahrsagereien zu tun. Ich weiß nicht, was dein Freund hier morgen machen wird, aber er wird mir zustimmen, wenn ich behaupte, ich hätte seinen Charakter anhand seines Schädels zutreffend beschrieben. Auch die Tatsache, dass du ein boshafter Agnostiker bist, findet sich an der Furche deines Jochbeins«, erwiderte Sontheimer ärgerlich und hielt die Antenne seines Telefons wie eine Stichwaffe auf den ob dieser Bedrohung nicht weiter eingeschüchterten Dr. gerichtet. Er hob die Schultern.
»Gegen solche weltanschauliche Rundschlüsse ist kein argumentatives Kraut gewachsen. Auf dieser Ebene diskutieren Sektenführer, aber keine Vernunftmenschen. Es ist eben nicht so, dass die Sonne aufgeht, weil ich morgens aufstehe, sondern ich stehe auf, weil die Sonne aufgeht. Genauso ist es mit meinen Eigenschaften: Du verwechselst Ursache und Wirkung und argumentierst, weil meine Schädelwölbungen so und nicht anders seien, sei ich ein Zweifler und Sophist. Richtig ist aber, dass ich zweifle und da dir diese Tatsache bekannt ist, bleibt dir nichts anderes übrig, als den Zweifel in meiner Kopfform zu finden. Alles übrige würde ja deine Theorie widerlegen. So ist das übrigens auch mit der Homöopathie. Dein Gall hat bei der Untersuchung von Mozarts Schädel doch tatsächlich anhand der überragenden Schädellappen auf dessen künstlerisches Genie geschlossen. Was für eine Erkenntnis! Mir hätte dafür das Allegro seines d-moll-Klavierkonzerts genügt!«, holte Klammer aus und es war Ärger in seiner Stimme zu hören.
»Das sicherste Merkmal geistiger Sterilität ist die Häufung von Tatsachen«, erwiderte Sontheimer überlegen. Sapher, der sich ein wenig allein gelassen fühlte, machte sich mit einem vorsichtigen Schmerzenslaut bemerkbar, der seine Ursache in einer unvorsichtigen Verlagerung des Körpergewichts auf sein angeschlagenes Bein hatte. Damit unterbrach er die Diskussion der beiden anderen abrupt, die sich einander bereits auf einen halben Meter genähert hatten und wie zwei Ringer aussahen, die sich vor ihrer entscheidenden körperlichen Auseinandersetzung durch ein leichtes Vorgeplänkel gegenseitig abschätzen. Sie wurden merklich kleiner, als sie nun zu Sapher sahen, der ihnen stumm und mit leidgeprüftem Gesicht seine blutverschmierte Armwunde zeigte.
»Ach, Benjamin, entschuldige! Ich habe mich mal wieder hinreißen lassen«, rief Klammer und schien ehrlich betrübt. »Es ist schrecklich mit mir. Weißt du, ich glaube, mein Mundwerk wird einmal erst eine halbe Stunde nach mir sterben.« Sapher gab ihm bei sich recht und bewunderte stumm die Geschmeidigkeit, mit der es seinem Vorgesetzten gelang, den förmlichen Büroumgangston abzustreifen und mit ihm familiär wie mit einem Freund umzugehen.
»Benjamin hatte einen kleinen Unfall vor deiner Haustüre«, erläuterte Klammer, »Die berüchtigte Schwelle hat ein weiteres Opfer gefunden. Wir sollten ihn erst einmal verarzten.« Sontheimer nickte zustimmend und sagte dann zornig:
»Ich habe dem Hausmeister sicher schon hundertmal gesagt, er möge den Eingangsbereich besser ausleuchten; aber es muss sich schon einer den Hals brechen, bis er mich endlich ernst nimmt. Ein Künstler kommt bei ihm in der Seriosität gleich nach einem Zirkusclown. Du könntest vielleicht auch mal etwas sagen, auf einen gesetzten Beamten wie dich hört er vielleicht.« Er ließ ein kurzes, spöttisches Lachen hören, sah auf die Armbanduhr, dann schüttelte er den Kopf. »Du weißt ja, wo das Bad ist, Nikolaus. Im Spiegelschrank sind Jod und Verbandszeug. Ich muss noch einen Anruf erledigen.«
»Na, dann komm mal, du Märtyrer«, sagte Klammer und nahm Sapher kameradschaftlich unter den Arm. »Leider wirst du noch einmal ein paar Stufen steigen müssen, das Bad ist oben.«
Er führte Benjamin, dessen Bein langsam wieder beweglicher wurde, übertrieben rücksichtsvoll die Wendeltreppe hinauf auf die Empore, die sich als das Wohnzimmer des Malers erwies, hier standen Möbel im Bauhausstil, ein Fernseher, die Stereoanlage und ein großes und rostiges Kunstobjekt, dessen scharfe Kanten gefährlich wirkten. Wie Sapher richtig vermutet hatte, war hier der eigentliche Wohnbereich. Ein halb geöffneter Vorhang aus festem Leder gab den Blick auf einen schmalen, dunklen Flur frei, von dem mehrere Türen abgingen. Klammer streifte mit einer zärtlichen Geste über den grauen Vorhang.
»Das ist Eselsleder, auch Chagrinleder genannt; das ist doch köstlich, nicht wahr?« Er hatte ein erheitertes Glucksen in der Stimme. Sapher wusste nicht, was er an dem narbigen Material, das ihn an eine alte Schultasche erinnerte, schön finden sollte. Er folgte Klammer in den kurzen Gang und von dort in ein geräumiges, nobles Badezimmer. Er kannte einen Anblick wie diesen nur aus den Werbeanzeigen von Sanitäreinrichtern mit italienisch klingenden Namen; es war das erste Mal, dass er solch ein Bad in natura sah. Wahrscheinlich war dieser Nassbereich teurer als die gesamte Einrichtung seines Eigenheime. Gleichzeitig plagte ihn Eifersucht, die er sich allerdings nicht eingestehen wollte. Auch hier hing an prominenter Stelle über der halb in den Boden eingelassenen Badewanne ein großes Bild – eine einzelne Brustwarze hinter Glas, diesmal im Profil. Die Brust, der sie entspross, war nicht vollständig gemalt, sondern nur pastellen angedeutet.
»Brauchst du eine Krankenschwester oder kommst du jetzt allein zurecht?« fragte der Dr. Sapher hörte ihm nicht zu, er dachte an Eva Rothschädl und bekam bei der Vorstellung, dass hier – vielleicht im Esszimmer – ein Gemälde ihrer Brust hing, eine Gänsehaut.
»Malt Sontheimer auch noch etwas anderes?«, fragte er kopfschüttelnd und klang besorgt. Es waren die ersten Worte, die er in der Wohnung des Malers sprach. Klammer, der sein Kopfschütteln für eine Antwort auf seine eben gestellte Frage hielt, deutete ein Lächeln an, machte gehorsam einen Waschlappen nass und begann, die Aufschürfungen an Saphers Arm zu säubern. Der ließ es sich wie eine Puppe gefallen und zog nur wegen des leichten Schmerzes die Augenbrauen zusammen.
»Wir werden den Arm nicht verbinden müssen, die Wunde hat sich schon gut verschorft. Nein«, beantwortete Klammer dann Saphers Frage, »Sontheimer malte früher ausschließlich und mit Leidenschaft Brustwarzen; in der Regel weibliche und nach der Natur. Wie du siehst, hat er es darin zu einiger Meisterschaft gebracht. Im Keller bewahrt er vierhundert oder mehr Gipsabgüsse von Brüsten auf. Leider zeigt er diese bemerkenswerte Sammlung nur seinen besten Freunden und das auch nur, wenn er sehr weinselig ist. Er hatte freilich eine ausgeklügelte Theorie über seine Kunst, aber ich will sie dir in unser beidem Interesse ersparen. Diderot hätte viel Freude an ihr gehabt. Wichtig ist daneben, dass seine zweifelsohne dekorativen Papillen unverwechselbar und einprägsam sind. Ein Kunstwerk, das in unserer Zeit verkäuflich sein soll, muss – außer dass es einer komplizieren Theorie entspringt, die niemand so richtig begreift und in der mindestens dreimal unmotiviert Heidegger zitiert wird – diese Kriterien erfüllen. Sontheimers Bilder verkaufen sich wie ein Sonderposten Katzenfutter.«
Sapher ging auf den krausen Vergleich nicht ein. Er setzte sich auf den Toilettendeckel, krempelte seine dunkle Hose, die glücklicherweise ganz geblieben und nur etwas schmutzig war, bis über das Knie hoch und begutachtete voller Selbstmitleid den großen Bluterguss, der sich dort bildete. Er bewegte vorsichtig das Gelenk. Verstaucht oder gezerrt hatte er sich wahrscheinlich nichts. Klammer hat recht, dachte er erleichtert, es ist halb so schlimm. Der Dr. wusch den Waschlappen aus, während er fortfuhr:
»In der letzten Zeit allerdings, in den letzten, sagen wir mal, drei Jahren, hat Sontheimer kein Bild mehr fertiggestellt. Da er durch seine Erbschaft finanziell abgesichert ist, spielt es weiter keine Rolle. Zudem sind noch zur Genüge alte Gemälde von ihm im Handel, samt einiger hervorragender Kopien eines seiner Schüler. Aber als Künstler ist er in einer schweren Sinnkrise. Ich schmeichele mir, daran nicht ohne Schuld zu sein.« Sapher hatte mehrere Fragen auf der Zunge, stellte dann aber die Offensichtliche.
»Was hast du denn damit zu tun?«
»Nun, wenn ein Künstler so weit kommt wie Sontheimer«, erwiderte Klammer, »wenn alles, egal, was er produziert, enthusiastisch gefeiert wird – sogar wenn er, entschuldige den derben Ausdruck, auf die Leinwand kackt – dann ist dieser Ruhm das Schlimmste, was ihm geschehen kann. Selbst das Gegenteil, wegen der Nichtanerkennung zu hungern, ist nicht so tragisch, denn dann kann er noch immer seiner selbst sicher sein. Wie aber kann er wissen, welche Qualität seine Schöpfungen haben, wenn jede Kritzelei, gleichgültig, wie viel oder wie wenig Mühe er sich gegeben hat, den gleichen begeisterten Erfolg zeigt? Und wie soll er sich weiterentwickeln? Es ist genau das, was einen guten Künstler auszeichnet: Er muss sich jeden Tag mühen, weiter zu kommen, etwas anders, neu zu machen.«