Parmas Erfolg begründet sich aber nicht nur in seiner Fähigkeit, zu jedem noch so abwegigen Thema etwas sagen zu können, das, falsch oder nicht, doch zumindest höchst intelligent klingt, sondern auch in seinem Publikum, das er gefunden hat und wie eine übereifrige Prostituierte umschmeichelt. Das sind Frauen um die Fünfzig, die alle dem begüterten Bildungsbürgertum angehören. Sie sind meist Lehrerinnen, auffallend oft Apothekerinnen und besitzen einen kleinen Laden; andere sind gut mit Ärzten, Rechtsanwälten, Lokalpolitikern und Autohändlern verheiratet. Allen gemeinsam ist, dass sie gelangweilt Abwechslung in den aufregend unangepassten Gefilden der Kunst suchen und sie finden sie ausgerechnet bei Parma. Gierig hängen sie an den Worten des eitlen, muskulösen und großgewachsenen Mannes, dem zwar zu seinem Leidwesen die Haare, nicht aber die Worte und die schmachtenden Gesten ausgehen, mit denen er diese Frauen zu spätklimakterischen Hitzewallungen treibt. Sein ranziger, südlicher Charme, sein paradoxer und aufdringlicher Snobismus und der Hauch des vorgeblich Genialen, mit dem sich der Hochstapler geschickt umgibt, sind so erfolgreich, dass sich kaum jemand ernsthaft die Mühe macht, nachzuforschen, ob die Lehrinhalte seiner Seminare sinnvoll, oder – diese Meinung habe ich – ein bodenloses, zum Himmel stinkendes Gebräu aus Unsinn, dreisten Verdrehungen oder einfach nur frechen und angeberischen Lügen sind. Obwohl es mir unbegreiflich ist, wie er diese Position bei der VHS überhaupt erreicht hat, klammert er sich verbissen an ihr fest und ist dort inzwischen unangreifbar.
Er ist zudem der glatteste und schmierigste, dabei bösartigste Kulturvampir der Stadt, der zur Mehrung seines Ruhmes die Begabungen junger Künstler ausnutzt, um sie dann ausgesaugt und leer wieder fallen zu lassen. Kürzlich hatte er seine klebrigen Finger nach dem neuen Stadtmagazin Metropolis, das ja im Gegensatz zu Werners Heft ein wenig Niveau hatte, ausgestreckt. Er teilte sich dort mit zwei weiteren Angebern den Rang des Chefredakteurs, schrieb egomanisch gesucht Zynisches über das, was er für den Zeitgeist hielt und hatte sicher im Hinterkopf das Ziel, sich zum regionalen Kulturpapst aufzuschwingen, zum Fritz Raddatz der Provinz. Außerdem war er zumindest teilweise daran schuld, dass ich mir vor einiger Zeit einen komplizierten Bruch des rechten Beins zugezogen hatte. Beim Wetterwechsel schmerzt es noch immer. Das ist jedoch eine andere Geschichte, die ich ihm dennoch nicht verzeihen kann. (1)

Ja, ich hasse ihn und hoffte, dass er Favelkas Wut nicht entgeht, wenn der sich eines hoffentlich nicht mehr allzu fernen Tages endlich dazu aufrafft, den Kugelschreiber gegen einen Revolver einzutauschen und ein paar offene Rechnungen erledigt!
»Kannst du mir die Telefonnummer von den beiden geben?«, erkundigte sich Theresa, während ich noch die Erwähnung von Parma verdaute.
»Bist du ganz sicher, ob du tatsächlich weißt, wie spät es ist?«, fragte ich zurück. »Du schaffst dir keine neuen Freunde, wenn du diese beiden auch noch aus dem Schlaf reißt. Ich mache dir einen anderen, vernünftigeren Vorschlag: Wir gehen morgen früh zu einer menschlichen Zeit gemeinsam zur MBB und meinetwegen auch zu diesem Parma und suchen deinen Freund, falls er bis dahin nicht wieder von selbst auftauchen sollte.« Ich machte eine Pause und lauschte eine Weile ihrem drückenden Schweigen. Schließlich sah ich mich genötigt, mich ein wenig genauer zu erklären: »Ich würde mir an deiner Stelle nicht so große Sorgen um Jonas machen. Du hast mir selbst erzählt, wie seltsam er manchmal ist. Wie du weißt, hatte ich in der Zwischenzeit mehrmals die leidvolle Gelegenheit, mich davon zu überzeugen. Mich sollte nicht wundern, wenn er nach einem Gespräch mit diesem Idioten Parma in eine Depression verfallen ist und er deshalb wütend durch die Kneipen zog und jetzt bei jemandem seinen Rausch ausschläft«, versuchte ich Theresa zu beruhigen. Ich denke nicht, dass mir das gelang. In unser beider Hinterkopf spukte auch noch eine weitere plausible Erklärung für sein Verschwinden, über die Theresa jedoch aus verständlichen Gründen nicht sprechen wollte: Nämlich jene, dass Nix eine andere Frau kennengelernt hatte und seine Freundin gerade betrog. Mir fiel die Wirtin vom Annapam ein, mit der er ja auf einer sehr intimen Ebene verkehrt hatte. Das war wahrscheinlich auch der wahre Grund, aus dem seine Freundin nicht bei der Mutter von Jonas anrufen wollte. Sie wollte sich vor ihr nicht lächerlich machen.
Theresa ging jedenfalls nach wenig Zögern auf meinen Vorschlag ein und wir verabredeten, dass sie mich am Morgen gegen neun Uhr mit ihrem Auto abholen sollte. Nur zögernd beendete sie unser Telefonat. Ich war nach dem Gespräch viel zu wach, um gleich wieder ins Bett zu gehen. Leider wollte Christine, die längst wieder eingeschlafen war, nichts davon wissen, jetzt gemeinsam mit mir einen Kaffee zu trinken, den Kühlschrank zu plündern und über die seltsamen Verstrickungen meines Schicksals mit dem von Nix zu philosophieren. So verbrachte ich den Rest der Nacht in der Küche und machte eine Filzstiftstudie von meinem besten Freund, der Kaffeemaschine. Das war eine Zeichnung, die mir hervorragend gelang und die ich später tatsächlich für einen guten Preis an den Hersteller des Gerätes verkaufen konnte. Ein cleveres Bürschchen in dessen Werbeabteilung kam nämlich auf die Idee, noch bei anderen Malern Kaffeemaschinenbilder zu bestellen und aus ihnen eine Plakatserie zu machen. Diese Zeichnung ist das bisher einzige Bild von mir, das kurzfristig über Litfass-Säulen in ganz Deutschland Verbreitung gefunden hat und wahrscheinlich jeder kennt. Obwohl sich meine Freunde nachhaltig darüber lustig machten, weiß ich, dass in ihrer Heiterkeit auch eine Portion Neid mitschwang. Ich genoss es, in allen Haushaltswarenabteilungen der Kaufhäuser für eine Weile auf die Reproduktionen einer Zeichnung von mir zu stoßen.
Früh am nächsten Morgen – ich war gerade bei der Rasur; es war noch ein ganze Stunde vor unserer Verabredung – stand Theresa bereits ungeduldig und nervös vor meiner Wohnungstür. Sie hatte noch immer nichts von Nix gehört. Es war ihr anzumerken, dass sie, so wie ich auch, den Rest der Nacht nicht geschlafen hatte. Ihr wächsern bleiches Gesicht, die schwarze Kleidung und ihr etwas verwischtes, dunkles Makeup verstärkten diesen Eindruck noch. Trotzdem wirkte sie fiebrig. Nix hatte sie in einem Interview als seine düstere Hel bezeichnet, fiel mir ein. Das war ein jetzt passender Name. Als ich ihr öffnete, hatte ich sofort das Verlangen, das Mädchen in den Arm zu nehmen und zu trösten. Wenn es mir mit ihrem unnachahmlichen, verschreckten Blick in die Augen sah, hätte es alles von mir verlangen können: Ich war wie Knetmasse in den Händen dieser dunklen Schönheit wie aus einem Vampirroman.
Ich führte Theresa in die Küche und überredete sie zu einem Frühstück. Ich machte ihr begreiflich, dass man an einem Samstag vor neun Uhr unmöglich bei der MBB auftauchen konnte, ohne es sich für immer mit ihr zu verscherzen. Obwohl ich erwartet hatte, sie würde höchstens eine Tasse schwarzen Kaffees akzeptieren, langte sie aber, während ich mich zu Ende rasierte, kräftig zu und machte auf meine Kaffeemaschinenzeichnung, die ich auf dem Küchentisch vergessen hatte und nicht rechtzeitig in Sicherheit brachte, mehrere große Fettflecke. Diese Beschmutzungen allerdings, wie ich bei nüchterner Betrachtung feststellte, gaben dem Ganzen jedoch den Pfiff, der ihm bislang noch gefehlt hatte. Theresa war wirklich die perfekte Muse. Allein ihre Anwesenheit schuf Kunst.
Ich führte Theresa in die Küche und überredete sie zu einem Frühstück. Ich machte ihr begreiflich, man könne an einem Samstag vor neun Uhr unmöglich bei der MBB auftauchen, ohne es sich für immer mit ihr zu verscherzen. Obwohl ich erwartet hatte, Theresa würde höchstens eine Tasse vom schwarzen Kaffees akzeptieren, langte sie, während ich mich zu Ende rasierte, kräftig zu und machte auf meine Kaffeemaschinenzeichnung, die ich auf dem Küchentisch vergessen hatte und nicht rechtzeitig in Sicherheit brachte, mehrere große Fettflecke. Diese Beschmutzungen allerdings – wie ich bei nüchterner Betrachtung feststellte -, gaben dem Ganzen jedoch den Pfiff, der ihm bislang noch gefehlt hatte. Theresa war wirklich die perfekte Muse. Allein ihre Anwesenheit und ihre von einer Butterbrezel fettigen schufen Kunst. Irgendwann tauchte auch mürrisch und verschlafen Christine auf. Ich weiß nicht, ob sie die echte Theresa mit der Zeichnung in Verbindung brachte, die ich einmal unabsichtlich von ihr gemacht hatte. Aber sie zog sich, ohne eine Erklärung dafür zu verlangen, warum eine ihr unbekannte Frau unseren Kühlschrank leerte, ins Bad zurück. Ich liebe sie für die Ruhe, mit der sie über solche Vorkommnisse hinweggeht.
(2) siehe: „Die Lichtung“, Erzählung. Enthalten in „Jahrmarkt in der Stadt, Band 1: „Kleine Lichter“.



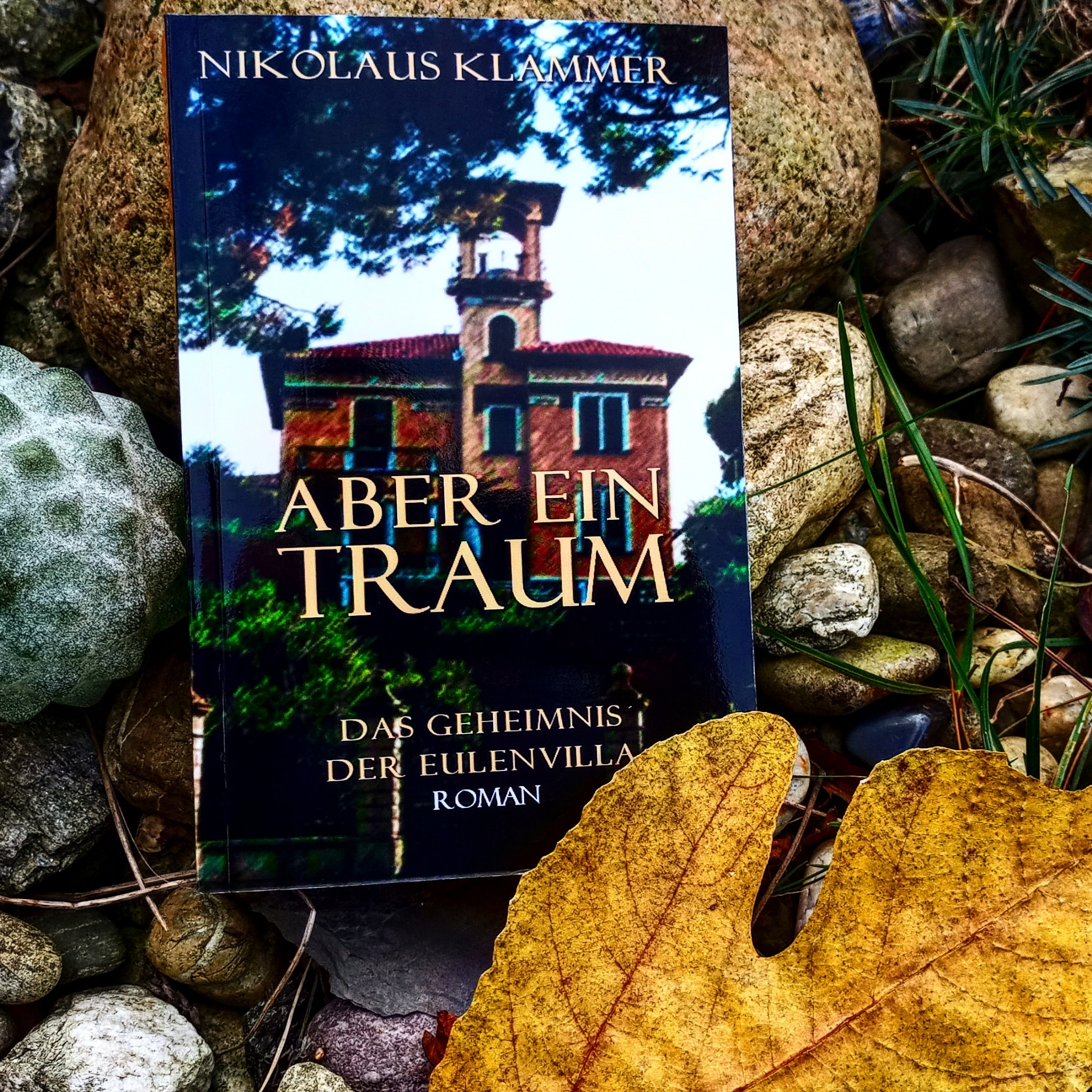

One thought on “Die Wahrheit über Jürgen – Ein Künstlerroman (Teil 30)”